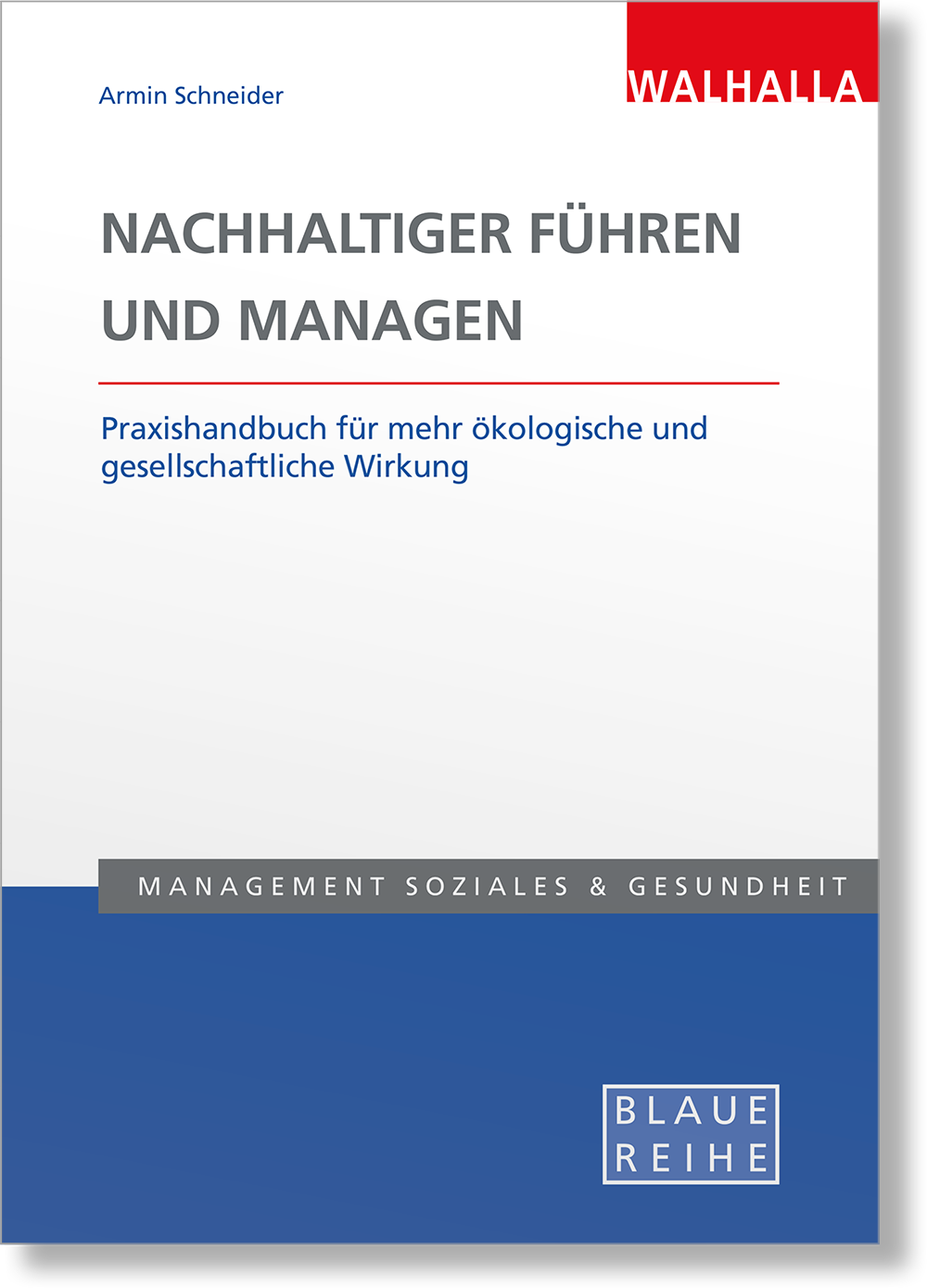Die Errungenschaften der Digitalisierung machen uns den Alltag einfacher und sorgloser – nie wieder lästige Stadtpläne ausfalten (zumindest die Älteren unter uns erinnern sich noch), Übersetzungen per Knopfdruck, Finanztransaktionen und die lästige Buchhaltung – für alles gibt es eine digitale Lösung. Wenn wir die englische Bezeichnung „Artificial Intelligence“ als „Künstliche Intelligenz“ übersetzen (und nicht etwa in künstlich generierte Information, was auch eine mögliche Übersetzung wäre) tun wir so, als könnten Computer in gleichem Maße wie wir Menschen intelligent sein. Von Prof. Dr. Armin Schneider
Das mag für die eine oder andere Anwendung gelten, doch scheint dies, zumindest bis zum Beweis des Gegenteils, recht naiv gedacht. Beziehen sich doch alle KI-Anwendungen auf eine Verknüpfung von vergangenen Daten und ihren Wahrscheinlichkeiten. Zumindest werden noch keine zukunftsweisenden Ideen entwickelt oder Probleme der Menschheit gelöst. Hinzu kommt, dass KI derzeit und in Zukunft ebenso wie alle Digitalisierung einen nicht zu vernachlässigenden ökologischen und sozialen Fußabdruck hinterlassen wird.
Auch der Austausch von Bits, so harmlos dies erscheinen mag, benötigt in Summe eine gewaltige Menge an Energie, und solange die Programmierer dieser KI in Verhältnissen der Ausbeutung arbeiten, kann hier nicht von „sauberer Zukunftstechnologie“ gesprochen werden. Schließlich wird nicht automatisch mit KI die natürliche Intelligenz gefördert, sondern es gehen, wie wir es alltäglich z.B. mit der Nutzung von Navigationssystemen er“fahren“, Eigenschaften der natürlichen Intelligenz, in diesem Beispiel die Orientierungsfähigkeit, verloren.
Der Softwarekonzern Oracle will für den Betrieb seines KI-Rechenzentrums drei neue Atomkraftwerke bauen (vgl. Bellinghausen 2024, S. 19), also weg von, oder gar nicht erst hin zu einer erneuerbaren Energieform. Klickarbeiter:innen in Niedriglohnländern arbeiten für die großen KI-Unternehmen (vgl. Schlindwein 2024). All dies ist zu bedenken, wenn wir allzu einfach die schöne neue KI-Welt bewundern. Es gilt auch hier, die Technologie nicht zu verteufeln, aber eben auch nicht zu glorifizieren. Genaues Hinsehen, aufmerksame Recherche, verantwortliche und verantwortbare Entscheidungen sind gefordert.
Was heißt dies für das Management und die Führung sozialer Unternehmen? Zu allererst die Einsicht, dass Digitalisierung und KI nicht per se Beiträge zur Nachhaltigkeit sind. Erst, wenn auch ihre „Fußabdrücke“ besser werden, können sie Wege zur Nachhaltigkeit öffnen. Oft genug werden die verdeckten ökologischen und gesellschaftlichen Kosten z.B. einer Videokonferenz längst nicht so offensichtlich wie z.B. die Kosten einer Face-to-Face Konferenz. In gewisser Weise kann auch hier von einer Externalisierung von ökologischen und gesellschaftlichen Kosten die Rede sein.
Dann ist zu fragen, welche Regeln im Unternehmen für die Nutzung, Bewertung und die Auswahl von digitalen und KI-Tools gelten. Welche Tools werden genutzt? Inwieweit macht man sich von den Technologiegiganten abhängig? Wie sind Systeme vor Hackerangriffen geschützt? Wie wird der Datenschutz gewährleistet? Wie die Persönlichkeits- und Urheberrechte der Mitarbeiter:innen und der Kund:innen?
Weiterhin sind der Stellenwert der natürlichen Intelligenz, des Grundlagenwissens und unterschiedlicher Kompetenzen gefragt, mit der beispielsweise KI-generierte Ergebnisse bewertet werden. KI ist ebenso wenig unfehlbar wie Menschen es sind.
Schließlich gilt es in sensiblen Bereichen, und dazu gehört gerade die Sozialwirtschaft, auf eine Nichtschädigung der anvertrauten Menschen zu achten. Hier wiederum ist natürliche, fehlbare aber zuwendungsstarke Intelligenz gefragt. Last but not least ist bei jedem Einsatz auch zu fragen, ob und wo nachhaltigere Alternativen zur Verfügung stehen, um ähnliche Ziele zu erreichen.
Tipps und Kniffe gibt es und sie werden sicherlich noch besser. Zum Beispiel bei Videokonferenzen:
• Videofunktion ausschalten, wenn sie nicht benötigt wird
• Herunterstellen der Videoqualität
• Nutzung des mobilen W-Lan statt des mobilen Internets
• Nutzung des Laptops statt des Desktop-PC (vgl. Energiekonsens 2021).
Was die KI angeht, so gilt:
• Zum Trainieren sorgsam minimalistisch vorgehen und mit kleineren Datenmengen arbeiten
• Messung und Transparenz der Energieflüsse durch KI
• Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme stellt z.B. Algorithmwatch vor:
o Transparenz und Verantwortungsübernahme
o Nicht-Diskriminierung und Fairness
o Technische Verlässlichkeit und menschliche Aufsicht
o Selbstbestimmung und Datenschutz
o Inklusives und partizipatives Design
o Kulturelle Sensibilität
o Marktvielfalt und Ausschöpfung des Innovationspotenzials
o Verteilungswirkung in Zielmärkten
o Arbeitsbedingungen und Arbeitsplätze
o Energieverbrauch
o CO2– und Treibhausgasemissionen
o Nachhaltigkeitspotenziale in der Anwendung
o Indirekter Ressourcenverbrauch“ (Algorithmwatch 2023)
Fazit:
Die Diskussionen über die Auswirkungen einer neuen Technik sind nicht neu, aber zu einem verantwortlichen Handeln gehört eben auch, gerade im Bezug auf Nachhaltigkeit, darauf zu achten, jede neue Technologie sorgfältig zu prüfen und sie dort einzusetzen, wo sie von großem Nutzen ist und dort skeptisch zu sein, wo negative Folgen vermutet werden.
Zum Buch:
Nachhaltiger führen und managen
Führungsaufgabe soziale und ökologische Nachhaltigkeit
Quellen:
Algorithmwatch (2023). Wie nachhaltig ist meine KI? https://sustain.algorithmwatch.org/wie-nachhaltig-ist-meine-ki/ Abruf: 29.09.2024.
Bellinghausen, Yves (2024). Der Softwarekonzern Oracle will drei Atomkraftwerke bauen, um genug Strom für künstliche Intelligenz zu haben. Was steckt dahinter? In: Die Zeit vom 26. September 2024, S. 19.
Energiekonsens (2021). CO2-Einsparung dank Videokonferenzen. Pressemitteilung vom 18. Februar 2021.
Schlindwein, Simone (2024). KI zwischen Hype und Ausbeutung. https://www.suedwind-magazin.at/ki-zwischen-hype-und-ausbeutung/ Abruf 29.09.2024.
Prof. Dr. Armin Schneider hat die Professur für Management und Forschung an der Hochschule Koblenz inne. Zudem ist er Direktor des Instituts für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit|Rheinland-Pfalz (IBEB). Er ist Autor von verschiedenen Büchern der Blauen Reihe Sozialmanagement bei WALHALLA.